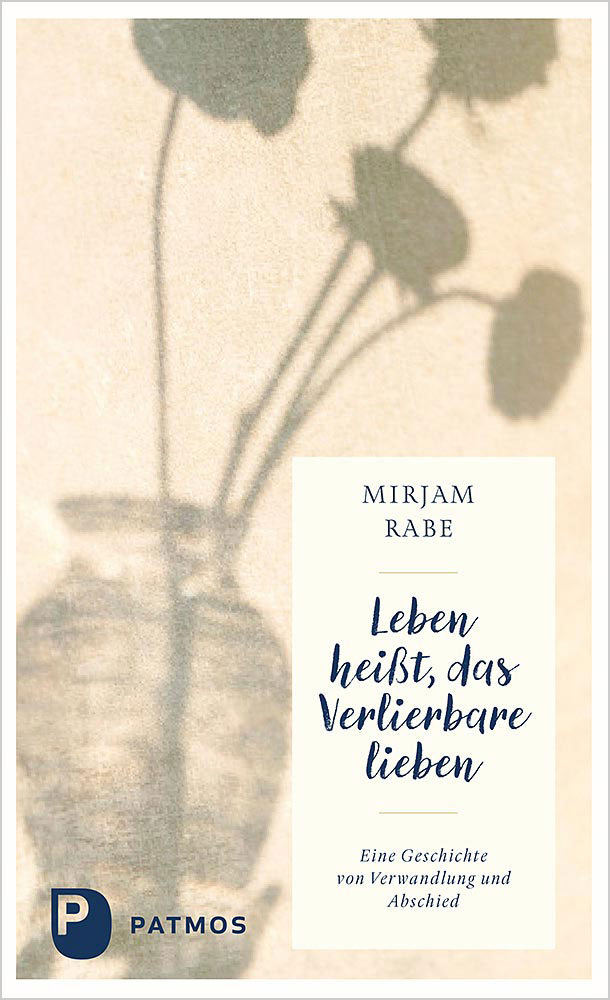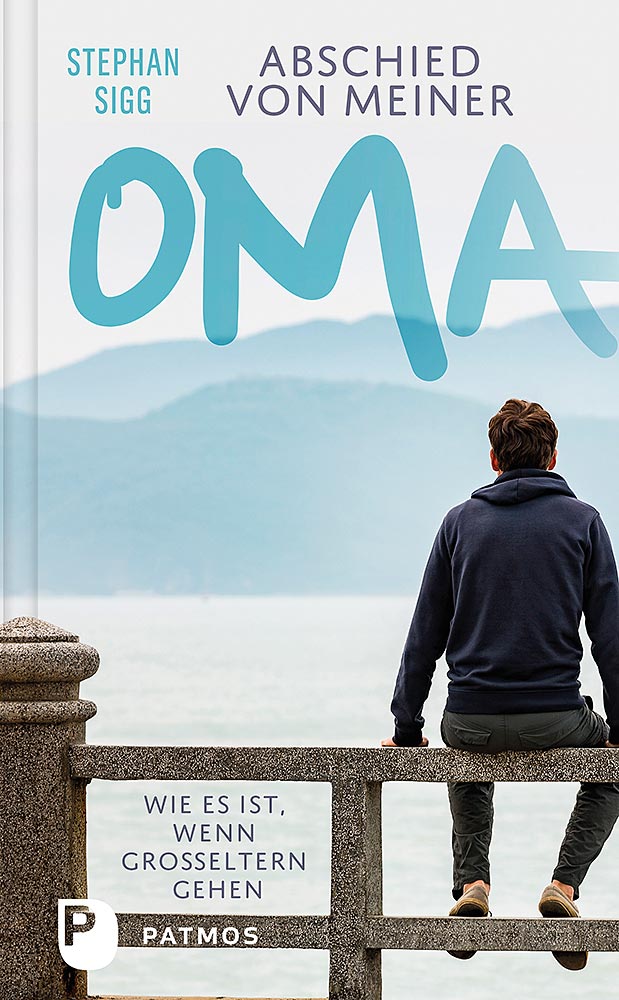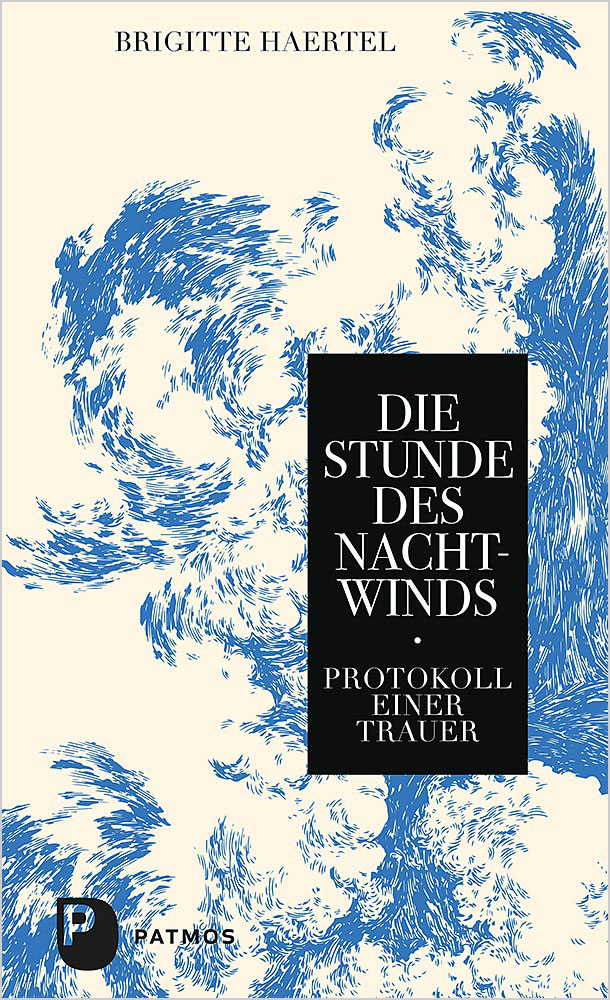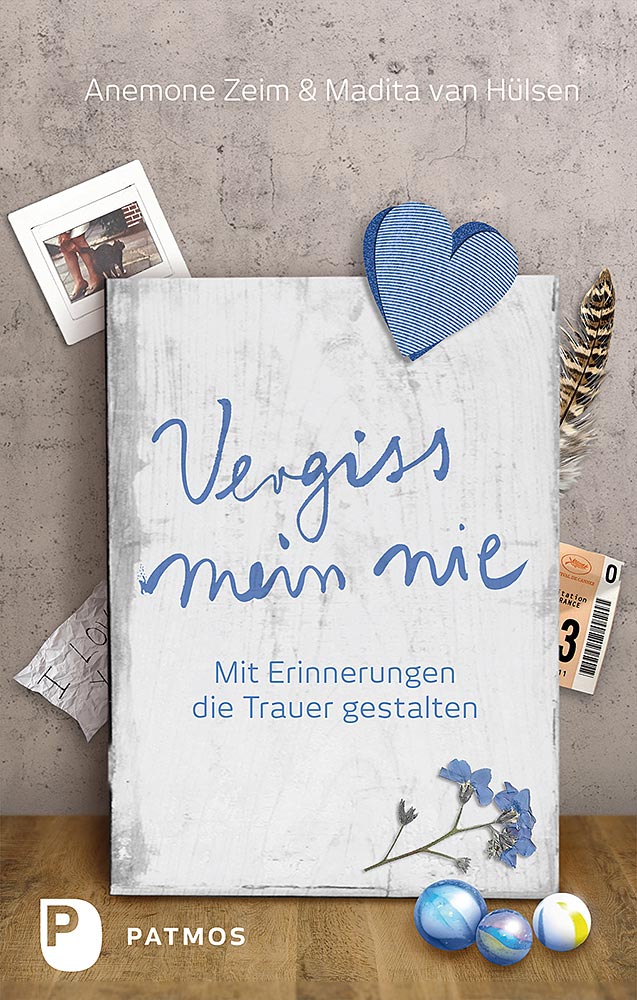Mirjam Rabes Buch »Leben heißt, das Verlierbare lieben« ist eine tiefgehende Reflexion über Verlust, Vergänglichkeit und den Umgang mit existenziellen Veränderungen. Es ist eine persönliche Erzählung, die von der Krankheit und dem Abschied eines geliebten Menschen handelt, aber zugleich eine universelle Betrachtung über das Leben selbst bietet.
In poetischer Sprache beschreibt Rabe die Erfahrung, einen nahestehenden Menschen durch eine schwere Krankheit allmählich zu verlieren – nicht nur physisch, sondern auch in der Art, wie die Beziehung sich verändert. Sie erzählt von den Herausforderungen, dem Abschiednehmen bei Lebzeiten und der gleichzeitigen Suche nach Halt, Trost und neuer Bedeutung.
Lebe gut: Frau Rabe, Ihr Buch ist sehr persönlich – was hat Sie dazu bewegt, diese Geschichte zu erzählen?
Mirjam Rabe: Das Buch ist geschrieben auf der Basis von Erinnerungen an die 14 Jahre mit meinem Vater, zwischen einem Zusammenbruch mit Hirnverletzung und seinem Tod. Zugleich ist es eine »universelle Betrachtung des Lebens«, das hat mir gefallen, wie Sie diese beiden Aspekte benannt haben. Man könnte auch sagen, dass mein Buch von Verletzlichkeit handelt und auch von der Frage, wie unsere Gesellschaft mit Verletzlichkeit umgeht. Verletzlichkeit gehört ja untrennbar zum Lebendigen, ist sozusagen Kennzeichen des Lebendigen. Im öffentlichen Diskurs gilt Verletzlichkeit aber oft als das, was nicht sein soll, was überwunden werden muss – oder wird gar nicht besprochen. Das heißt, wir sprechen von »vulnerablen Gruppen« von Erfahrungen des Behindert-seins, wenig aber von der Verletzlichkeit, die alle Menschen verbindet. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, Worte zu finden, Geschichten zu erzählen und Abschied und Verlust auch in ihrer bereichernden Dimension zu sehen und sein zu lassen. So habe ich die Hoffnung, mit meinem Buch ein wenig zu einem anderen Sprechen über Verletzlichkeit beitragen zu können.
Erinnerungen als Kraftquelle
Lebe gut: In Ihrem Buch spielt die Erinnerung eine zentrale Rolle. Wie kann man Erinnerungen als Kraftquelle nutzen, anstatt von ihnen erdrückt zu werden?
Mirjam Rabe: Das ist eine wichtige, eine starke Frage, die mich immer wieder und auch ganz aktuell beschäftigt. Erinnerungen können trösten, können aber auch unerträglich werden, wenn sie die Sehnsucht wecken, das Erinnerte wieder zu erleben und dies nicht möglich ist. Wie kann man Erinnerungen als Kraftquelle nutzen? Es kann helfen, sich von der Vorstellung von Zeit als einem Zeitstrahl zu lösen, bei dem die jeweils erlebte Gegenwart ein markierbarer Punkt wäre. Von dieser Vorstellung sind wir geprägt durch die Zeitzählung, durch Kalender und in dieser Vorstellung ist das Vergangene wie in einem anderen Raum, der nun hinter einem liegt und geschlossen ist, kein Weg führt zurück. Dabei sind unsere Erinnerungen uns tatsächlich nicht äußerlich: Wir wären nicht diejenigen, die wir jetzt sind ohne das Gewesene, Erlebte, Erinnerte und das lebendige Erinnern selbst geschieht in der Gegenwart und füllt diese aus und in diesem Sinne ist das Erinnerte in der Gegenwart und ragt auch in die Zukunft. Wenn wir so das Erinnerte denken, kann es möglich werden neben der Trauer um das Verlorene auch eine Freude zu empfinden über das Gewesene, aus einer Feindschaft mit der Zeit als das Vergehende zu treten, auch das Vergangene als wirklich zu uns gehörend oder in uns wahrzunehmen.
Lebe gut: Ihr Buch trägt den Titel »Leben heißt, das Verlierbare lieben«. Wie kann man lernen, das Vergehende nicht zu fürchten, sondern zu lieben?
Mirjam Rabe: In der Formulierung »Leben heißt…« ist diese Erfahrung des möglichen oder wirklichen Verlusts auf eine allgemeine Ebene gehoben, weist also über eine persönlich erlebte Geschichte hinaus in die Verletzlichkeit, Verlierbarkeit, Endlichkeit, die alle Menschen (eigentlich: alle Lebewesen) verbindet. Was wir lieben ist das Lebendige, und ist damit immer verletzlich und verlierbar. In ‚das Verlierbare lieben‘ ist zugleich ein Dennoch: Annehmen, dass das Geliebte verlierbar ist und dennoch lieben. Das erfordert Mut, weil wir uns gerade darin aufs Äußerste verletzlich machen und es vielleicht in Momenten einfacher scheinen mag, sich zu verschließen aus Angst vor Verlust.
Begegnung mit dem Umfeld
Lebe gut: Sie schreiben auch über die Blicke der anderen – wie verändert sich die Wahrnehmung durch Außenstehende, wenn ein Mensch krank wird?
Mirjam Rabe: Die Außenstehenden sind ja Individuen, daher gibt es da sicher keine pauschale Antwort. Aber ich denke oft ist es so, dass wir gut mit den Ich-Anteilen im anderen Menschen umgehen können, mit denen wir auch in uns selbst umgehen können. Wer in sich verletzliche Anteile lieber verdrängt, wird sich auch schwer damit tun, Schwäche, Bedrohtheit des Lebens, Bedürftigkeit im anderen Menschen zu begegnen. Das kann sich in Befangenheit äußern oder auch in einem vielleicht oft selbst nicht eingestandenen Gefühl des Überlegenseins (hier kann ich in der Rolle der Starken, Gesunden sein). In jedem Fall stellt sich die Frage: Bin ich bereit den anderen Menschen zu sehen, durch die Bilder hindurch, die ich mir von ihm gemacht habe? Die Bilder mögen eine Stabilität und Einheitlichkeit suggerieren, die dann im Gegenüber auf einmal gar nicht mehr vorfindbar ist. Ich glaube allerdings, dass diese Einheitlichkeit immer auf eine Weise Fiktion ist. Durch Erkrankung wird ein Mensch aus den Rollen geworfen, mit denen er sich auch selbst identifiziert(e) und es zeigt sich in den sozialen Beziehungen, welche Verbindungen vor allem auf die Erfüllung dieser Rollen und Erwartungen ausgerichtet waren und in welchen Beziehungen der Mensch als Gegenüber auch mit einer unergründbaren Tiefe gemeint ist.
Die Sprache der Trauer
Lebe gut: Oft fällt es Menschen schwer, über Verlust zu sprechen. Sie finden Worte für das Unsagbare – wie gelingt das?
Mirjam Rabe: Ich glaube, für eine Sprache, die in Allgemeinbegriffen formuliert, bleibt tatsächlich das Lebendige, das tief Erlebte immer unsagbar. Eine solche Sprache kann bestenfalls den Raum für das Unsagbare freilassen, indem sie sagt, ich kann bis hierher gehen und nicht weiter, dort ist Erfahrung. Ich habe versucht, Allgemeinbegriffe zu vermeiden und stattdessen tief in die erlebten Situationen hineinzugehen, in die Wahrnehmung des Raums, des Anderen, der Gefühle, Gedanken, Körperempfindungen und schließlich durch den Fluss und die Melodie der Worte, eine Stimmung festzuhalten, um sie mit anderen zu teilen.
Lebe gut: Sie beschreiben einen »Abschied in kleinen Schritten«. Wie unterscheidet sich diese Art von Trauer von der nach einem endgültigen Verlust?
Mirjam Rabe: Es ist eine aufgehaltene, eine zurückgehaltene Trauer, in der kein klares Loslassen und Neuanfang möglich ist. Aber es ist auch eine Haltung dem Leben gegenüber, die da eingeübt werden kann, und in dem ständigen Abschiednehmen auch die Erfahrung einer Wandlungsfähigkeit. Mir sind die Grenzen, ja ist selbst die Grenze des Todes auf eine Weise weich geworden in diesem langen Abschied. Aber das Loslassen-müssen im, in bestimmter Hinsicht, endgültigen Verlust durch den Tod war auch eine Befreiung vom Leben im Abschied.
Der Trauer genügend Raum geben
Lebe gut: Gibt es etwas, das Sie aus diesem langen Prozess für sich mitgenommen haben? Etwas, das Ihnen Trost gibt?
Mirjam Rabe: Dass es viele Formen der liebevollen Beziehung zwischen Menschen gibt, auch jenseits der vertrauten Rollen, viele, auch wort-lose Sprachen der Zuneigung. Dass Erfülltsein manchmal da zu finden ist, wo wir es gar nicht vermutet haben, in jedem Fall nicht in der Abwesenheit von Verletzlichkeit.
Lebe gut: Was würden Sie jemandem raten, der sich gerade von einem geliebten Menschen verabschieden muss?
Mirjam Rabe: Allem Raum geben, was in einem lebendig ist. Alles, was davor bewahrt, dass in einem etwas zum Stillstand kommt, ist gut. Es kann sehr helfen, den Gefühlen eine Ausdrucksgestalt zu geben, in Sprache, Farben, Tanz. Mir hat die Einsicht geholfen, dass der Tod eines geliebten Menschen nicht den Tod der inneren Beziehung bedeuten muss, dass die eigene Lebendigkeit, die in dieser Beziehung auch fühlbar war, nicht ebenso sterben muss und es möglich ist, weiter zu lieben, ja, über die Grenze hinweg zu lieben.
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter und erhalten Sie jede Woche weitere interessante Impulse, Geschichten und Rezepte.